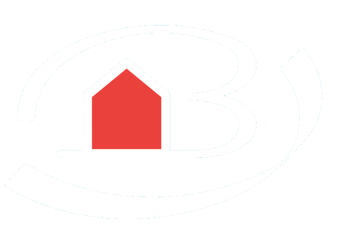Familie B. sucht schon seit längerem ein bezahlbares Eigenheim in der Metropolregion München. Endlich scheint das passende Objekt gefunden zu sein: ein gemütliches Einfamilienhaus mit idealer Raumaufteilung, ein Fertighaus der Firma Okal von 1972. Doch bei der Besichtigung fällt der Familie ein eigenartiger Geruch auf. Recherchen von Frau B. sorgen jetzt für Verunsicherung: ältere Fertighäuser sollen schadstoffbelastet sein.
„Problemfall Fertighaus: Schadstoff- und Geruchsbelastung“ weiterlesenChloranisole: hartnäckiger Mief im Haus
Der Schock der Besucher ist intensiv und lange anhaltend – ganz im wahren Sinn des Wortes. Für die Besitzer betroffener Häuser können Chloranisole gar existenzbedrohend sein. Nicht nur, dass Immobilien enormen Wertverlust erleiden, auch soziale Ächtung kann die Bewohner treffen.
„Chloranisole: hartnäckiger Mief im Haus“ weiterlesenGefährlicher Schimmelpilzbefall: Myriaden* an Sporen in der Raumluft
Cleveland, 1997. In der amerikanischen Großstadt erkranken ungewöhnlich viele Säuglinge an der Lunge. Von 30 schwer erkrankten Babys sterben 9. Die Häuser in denen die betroffenen Familien wohnen, haben eines gemeinsam: Aufgrund eines Hochwassers sind sie feucht. An den Wänden wuchern Schimmelpilze. Tatsächlich wird der Schimmelpilzbefall als Verursacher der Erkrankungen bestätigt.
„Gefährlicher Schimmelpilzbefall: Myriaden* an Sporen in der Raumluft“ weiterlesen